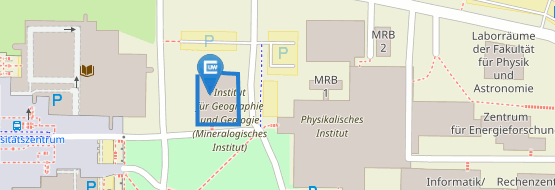Forschung
Laufend

PlanToConnect – Mainstreaming ecological connectivity in spatial planning systems of the Alpine Space
- Fördermittelgeber: Interreg Alpine Space Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)
- Laufzeit: 11/2022 – 10/2025
- Gesamtbudget Projekt: 2.461.927,46 EUR
- Kofinanzierung der Europäischen Union: 1.846.445,59 EUR
- Teilbudget JMU: 300.966,76 EUR (EU-Kofinanzierung: 225.725,07 EUR)
- Projektwebseite: https://www.alpine-space.eu/project/plantoconnect
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Kerstin Ströbel, M. Sc., Constantin Meyer, M.Sc.
Die Stärkung des ökologischen Verbunds ist eine wichtige Voraussetzung, um dynamische Anpassungsprozesse in Ökosystemen zu ermöglichen und so dem Rückgang der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, insbesondere im Hinblick auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen. Während Schutzgebiete i.d.R. flächendeckend etabliert sind, leidet ihre Verbindung durch Grüne und Blaue Infrastruktur/ökologische Korridore unter erheblichen Planungsdefiziten, fehlender Umsetzung und aufkommenden Risiken wie der Erzeugung erneuerbarer Energien im Offenland. Ein übergreifendes Konzept zur Planung der ökologischen Vernetzung, das die Umsetzung der (transnationalen) Korridore in den Alpen regelt, fehlt derzeit. Daher müssen regionale Netzwerke, einschließlich der Planungsmethodik von Korridoren, harmonisiert und die Raumplanungssysteme im Alpenraum entsprechend weiterentwickelt werden. Das Know-how und die Erfahrungen, die im Rahmen von PlanToConnect und in früheren Alpenraumprojekten (z.B. ALPBIONET2030, OpenSpaceAlps) entwickelt wurden, werden auf die Planung ökologischer Netzwerke in den Partnerregionen angewandt und dort erprobt - ein Schritt zur Entwicklung eines kohärenten Netzwerks Grüner und Blauer Infrastruktur im gesamten Alpenraum. Das Projekt PlanToConnect umfasst zehn Partnerorganisationen aus fünf Alpenländern.

Gesundheitsrelevante Effekte urbaner Waldstrukturen
- Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Laufzeit: 05/2022 – 04/2025
- Budget: 365.000 EUR
- Leitung und Ansprechpartner: PD Dr. Joachim Rathmann
In dem interdisziplinären Projekt ist das übergreifende Ziel, die Identifizierung der unterschiedlichen "Strukturtypen" des Augsburgern Stadtwaldes mit seiner Umgebung durch verschiedene Methoden/Techniken der Projektpartner (Prof. Dr. Elisabeth André. Lst. für Menschzentrierte KI, PD Dr. Christoph Beck, Phys. Geogr. mit Schwerpunkt Klimaforschung, Universität Augsburg). Hierbei sollen Kategorien bestimmt werden, die sowohl hinsichtlich lokal- und humanbioklimatischer als auch weiterer potenziell gesundheitsrelevanter Parameter möglichst klar abgrenzbare waldstrukturelle Charakteristika repräsentieren. Die relevanten Waldstrukturtypen werden nachfolgend möglichst umfassend hinsichtlich ihrer spezifischen Ausprägungen gesundheitsrelevanter Parameter – sowohl lokal- und humanbioklimatische als auch nichtklimatische (subjektive Wahrnehmung, humanphysiologische Effekte) – charakterisiert.

Methodische Weiterentwicklung regionalökonomischer Wirkungsanalysen des Naturtourismus in den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands: Applikation der multi-regionalen Input-Output-Analyse
- Fördermittelgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
- Laufzeit: 04/2022 – 09/2023
- Budget: 125.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Lisa Majewski
Schutzgebiete schützen nicht nur wertvolle Natur- und Kulturlandschaften, sondern sind bedeutende Wirtschaftsmotoren für regionale und nationale Ökonomien. Der Naturtourismus sichert Einkommen und Beschäftigung für die lokale Bevölkerung und durch seine Einnahmen wird der Naturschutz vor Ort weiter gestärkt. Um die ökonomischen Effekte des Naturtourismus zu verstehen, haben sich im Laufe der Zeit zahlreiche Methoden entwickelt. In Deutschland wurde bislang in allen Studien die Wertschöpfungsanalyse standardmäßig eingesetzt. Die internationale Forschung arbeitet hingegen mit der detailreicheren und dadurch verlässlicheren Input-Output-Methode, um naturtouristische Multiplikatoreffekte zu bemessen. Im Rahmen dieses Vorhabens wird die Methodik regionalökonomischer Wirkungsanalysen in Deutschlands Schutzgebieten weiterentwickelt, indem für die Nationalparke und UNESCO-Weltnaturerbe Niedersächsisches, Hamburgisches und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer eine multi-regionale Input-Output-Analyse durchgeführt wird. Das multi-regionale Input-Output-Modell erlaubt eine Abbildung nationaler Vorleistungs- und Konsumeffekte, die von naturtouristischen Ausgaben in der Untersuchungsregion an der Nordseeküste ausgehen. Die Erkenntnisse werden mit gleichzeitig vorliegenden Ergebnissen von Wertschöpfungsanalysen in den drei Schutzgebietsregionen gegenübergestellt, um methodische Implikationen für das Besuchermonitoring ableiten zu können.

Untersuchung der regionalökonomischen Effekte des Naturtourismus im Naturpark Lüneburger Heide
- Fördermittelgeber: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, Schneverdingen/Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., Amelinghausen
- Laufzeit: 03/2022 – 09/2024
- Budget: 46.900 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Anna Frieser M.Sc., Dr. Manuel Woltering
Der Naturpark Lüneburger Heide als erster Naturpark Deutschlands zeichnet sich besonders durch das Zusammenspiel von natürlichen und menschlichen Einflüssen aus. Geformt durch eiszeitliche Prozesse und der landwirtschaftlichen Nutzung der Menschen ist die dort charakteristische Heidelandschaft entstanden, welche für die Bevölkerung schon lange einen besonderen Stellenwert in der Naherholung einnimmt. Damit die Kulturlandschaft der Lüneburger Heide auch heute noch erlebbar ist und als Lebensraum für viele seltenen Pflanzen- und Tierarten fungieren kann, wurde sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts um eine Unterschutzstellung bemüht. Ziel des Forthabens ist die Quantifizierung der wirtschaftlichen Bedeutung des Naturtourismus im Naturpark Lüneburger Heide.

ARL European Working Group "AlpPlan - alpine spatial planning network"
- Partnerinstitution: Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)
- Laufzeit: fortlaufend, seit 10/2020
- Budget: Fortlaufend aus Haushaltsmitteln für Forschung und Lehre
- Projektwebseite: https://www.arl-international.com/activities/alpplan-network
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Constantin Meyer, M.Sc.
AlpPlan ist eine European Working Group (EWG) im Alpenraum, die aus einer Kooperation des Interreg Alpine Space Projekt OpenSpaceAlps und der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) hervorgegangen ist. Die Umsetzung der Ziele der Alpenkonvention und deren Koordination durch die Raumplanung bilden einen wichtigen Rahmen für die Aktivitäten des Netzwerks. Das übergeordnete Ziel von AlpPlan ist die Förderung der Kooperation und Koordination im Bereich der Raumplanung im Alpenraum, insbesondere aus grenzüberschreitender Sicht. Durch gegenseitigen Austausch und Zusammenarbeit will das Netzwerk zu einer nachhaltigen Raumentwicklung aus ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht beitragen. Der Nutzen des Netzwerks wird insbesondere darin gesehen, dass AlpPlan sowohl wissenschaftliche Expertise als auch praxisorientierte Anwendungsperspektiven zusammenführt.

Regionalwirtschaftliche Effekte des nachhaltigen Tourismus in Naturparken und ’Total Economic Valuation’ der Nationalen Naturlandschaften
- Fördermittelgeber: UFOPLAN – BMU/Bundesamt für Naturschutz, Bonn
- Laufzeit: 07/2020 – 12/2024
- Budget: 508.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Anna Frieser, M.Sc., Dr. Lisa Majewski, Dr. Manuel Woltering
In den vergangenen Jahren wurden mittlerweile beinahe alle deutschen Nationalparke und Biosphärenreservate hinsichtlich ihrer regionalökonomischen Wirkungen auf die umgebenden Regionen untersucht. Die daraus hervorgehenden Daten wie z.B. die Besucher pro Jahr oder der Anteil der Gäste, die wegen des jeweiligen Schutzgebietsstatus kommen, sind Bestandteil des Integrativen Monitoring-Programms des Bundes und der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA). Für die Kategorie der Naturparke steht eine solche Abschätzung ihres tourismuswirtschaftlichen Stellenwerts in Deutschland derzeit noch aus. Aufgrund der großen Anzahl an Naturparken mit mehr als 100 Vertretern ist allerdings eine durchgehende einzelfallweise Betrachtung nicht umsetzbar. Vielmehr wird auf Basis von Detailkenntnissen zu ausgewählten Fallbeispielen mittels Extrapolation eine bundesweite Aussage vorgenommen. Darüber hinaus ist es das Ziel des Vorhabens, auf Basis der dann für alle drei Kategorien Nationaler Naturlandschaften vorliegenden Ergebnisse zur ökonomischen Bedeutung des Tourismus sowie weiterführender Analysen erstmals eine ‚Total Economic Valuation‘ vorzunehmen.

Regionalökonomische Effekte des Tourismus im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer als Beitrag zur verbesserten Vermittlung der Naturwerte
- Fördermittelgeber: Nationalparkstiftung Schleswig-Holstein
- Laufzeit: 03/2021 - 03/2023
- Budget: 105.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Dr. Manuel Woltering
Das Wattenmeer als einzigartiger Naturraum mit weltweiter Bedeutung für den Vogelzug ist ein schützenswerter Raum. Die Ausweisung als Nationalpark hat das Ziel, einen ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Darüber hinaus soll dieser der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. Das nordfriesische Festland, die Inseln und Halligen sind seit jeher ein touristisches Highlight und hoch frequentiert. Mit der Studie soll neben der Rolle des Nationalparks als Reisemotiv auch die wachsende Rolle des UNESCO-Biosphärenreservats und des Prädikats UNESCO-Weltnaturerbe in der Analyse berücksichtigt werden. Das Interesse liegt auf den Reiseentscheidungen der Besucher und ihren touristischen Ausgaben, um den ökonomischen Stellenwert des Tourismus für die Region zu untersuchen. Die erste und bisher einzige Erhebung für das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer fand 2012 statt und erfährt nun durch eine methodisch vergleichbare Untersuchung neue Ergebnisse über touristische Entwicklungen.
Abgeschlossen (seit 2015)
Regionalökonomische Effekte des Tourismus in der Biosphärenregion Berchtesgadener Land
- Fördermittelgeber: Regierung von Oberbayern
- Laufzeit: 01/2021 – 10/2022
- Budget: 65.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Dr. Manuel Woltering
Regionalökonomische Effekte des Tourismus in den Nationalparken Hamburgisches und Niedersächsisches Wattenmeer
- Fördermittelgeber: Nationalparkverwaltungen Hamburgisches und Niedersächsisches Wattenmeer
- Laufzeit: 12/2018 – 09/2022
- Budget: 135.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Dr. Manuel Woltering
OpenSpaceAlps – Sustainable development of alpine open spaces by enhancing spatial planning governance
- Fördermittelgeber: Interreg Alpine Space Programm (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)
- Laufzeit: 10/2019 – 06/2022
- Budget: 128.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Constantin Meyer, M.Sc.
Ermittlung der sozioökonomischen Effekte des Tourismus in deutschen UNESCO Biosphärenreservaten
- Fördermittelgeber: UFOPLAN – BMUB/Bundesamt für Naturschutz, Bonn
- Laufzeit: 04/2016 – 05/2022
- Budget: 545.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Manuel Engelbauer, Dr. Lisa Majewski, Dr. Manuel Woltering
Biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen von Wäldern mit Fokus auf Holz: Neue Wege der nachhaltigen Nutzung im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ökonomie und Klimawandel (BioHolz)
- Fördermittelgeber: BMUB/BMBF, Berlin
- Laufzeit: 07/2015 – 06/2021
- Budget: 438.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: PD Dr. Joachim Rathmann
Potenzialanalyse des Naturtourismus im Biosphärengebiet Schwarzwald
- Fördermittelgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU); Osnabrück
- Laufzeit: 07/2015 – 06/2021
- Budget: 125.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Lisa Majewski
Akzeptanz des Nationalparks Berchtesgaden bei der lokalen Bevölkerung sowie in Bayern
- Fördermittelgeber: Nationalparkverwaltung Berchtesgaden
- Laufzeit: 01/2018 – 12/2018
- Budget: 48.500 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Dr. Manuel Woltering
Akzeptanz des Nationalparks Bayerischer Wald bei der lokalen Bevölkerung sowie in Bayern
- Fördermittelgeber: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
- Laufzeit: 06/2017 – 09/2018
- Budget: 48.500 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Sarah Bittlingmaier, M.Sc., Dr. Manuel Woltering
Aktuelle und potentielle regionalökonomische Effekte durch Naturtourismus in den Naturparken Kyffhäuser und Südharz
- Fördermittelgeber: Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz
- Laufzeit: 10/2016 – 03/2018
- Budget: 116.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Manuel Engelbauer, Dr. Manuel Woltering
Sozioökonomische Evaluierung möglicher Nationalpark-Regionen
- Fördermittelgeber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
- Laufzeit: 04/2017 – 07/2017
- Budget: 40.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Manuel Engelbauer, Dr. Manuel Woltering
Nationalparke, Naturtourismus und demographischer Wandel in Deutschland: Potenzielle Effekte auf Frequentierung, Strukturen und raumzeitliche Bewegungsmuster von Besuchern
- Fördermittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn
- Laufzeit: 07/2014 – 06/2016
- Budget: 147.000 EUR
- Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hubert Job
- Ansprechpartner: Dr. Johannes Schamel